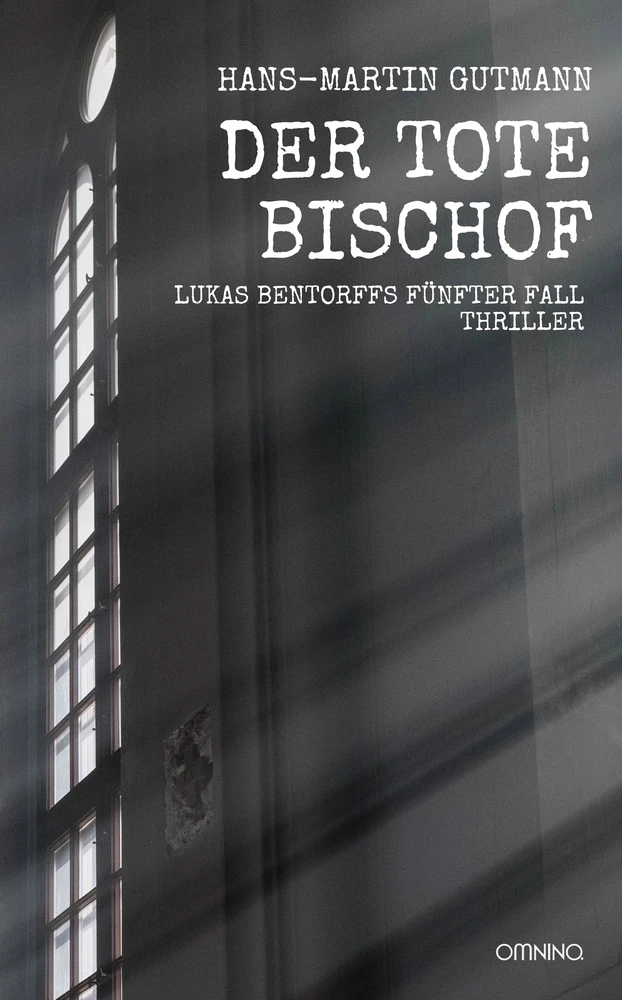Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1
„Das ist ein Sandhaufen. Das ist kein Ungeheuer!“
Nichts zu machen. Der Sandhaufen war gestern noch nicht hier. Unser abendlicher Spaziergang duldet in seinen Augen keine Veränderung. Erst recht keine Überraschung.
Ich gucke auf die Uhr. Fünf Minuten. So lange rührt sich Iwan schon nicht vom Fleck und bellt den Sandhaufen an.
Iwan ist jetzt anderthalb. Voll ausgewachsen. Voll pubertär. Voll neurotisch.
Durchgedreht wäre der angemessenere Ausdruck.
Okay. Ich habe heute Abend nicht mehr viel vor. Außer Schreibtisch.
Ach so, ja, Iwan ist Bernhardiner. Zweiundsiebzig Kilo. Stark wie ein Trecker. Wenn er laufen will, läuft er. Nichts wird ihn aufhalten. Wenn er stehen will, steht er. Wie ein Fels.
Dann heißt es warten, bis sich der Anfall gelegt hat.
Ich bin selbst schuld. Ich wollte einen großen Hund. Nicht so ein Kleintier, wie sie jetzt massenhaft auf den Bürgersteigen Salzgitters von älteren Damen ausgeführt werden. Und oft auch von jungen Paaren. Die mit ihrem kleinen Schatz sprechen und sich überhaupt so verhalten, als wäre es ein kleines Menschenkind.
Hätte ich Iwan vor fünfzehn Monaten trotzdem genommen, an diesem verregneten Nachmittag beim Tierhändler in Braunsruh? Als ich mich in dieses spielerische Wollknäuel spontan verliebt habe? Wenn ich gewusst hätte, dass dieser Hund, gelinde gesagt, einen Knall hat?
Wahrscheinlich ja.
Ich ziehe ein wenig an der Leine. Keine Chance einstweilen. Iwan hat seiner Empörung noch nicht genügend Ausdruck gegeben.
Eigentlich wollte ich kein Tier mehr im Haus, nachdem Kalle im stolzen Alter von einundzwanzig Jahren den Weg aller Welt gegangen war. Kalle war mein Freund. Dieser stolze, zum Jagen unfähige, strohdumme und vom Leben leicht überforderte Kater. Ich habe wochenlang um ihn getrauert. Monatelang.
Mein abendlicher Spazierweg mit Iwan führt an seinem Grab vorbei. Ich habe es selbst gegraben. Am Rande des Friedhofes. Jedes Mal, wenn wir vorbeikommen, ist das eine nächtlich todtraurige Station.
Iwan hat sich dran gewöhnt, dass ich es in diesem Fall bin, der eine Zeitlang verweilt. Und Kalle ein paar gute Gedanken hinterherschickt.
Kalles clevere Schwester Lilo war schon Monate vorher irgendwo im Dorf verschwunden. Wahrscheinlich lebt sie ewig. Wahrscheinlich jagt sie immer noch Amseln. Oder sonnt sich auf irgendeinem Ast und sinniert über die wilde Schönheit des Lebens.
Ich habe danach jahrelang ohne Tier gelebt.
Ohne Tiere ist Leben möglich. Aber sinnlos.
Das habe ich aber erst gemerkt, seit Iwan in mein Leben getreten ist.
Genauer: Reingeschossen ist wie eine durchgedrehte Dampfwalze.
Die Entscheidung fiel bei einem Besuch bei Klaus, meinem Hausarzt. Einem meiner wenigen dörflichen Freunde.
„Du bist mit einer goldenen Leber gesegnet, mein Lieber. Verstehen tue ich das nicht, bei deinem Whiskeykonsum. Aber du musst auch an den Rest vom Körper denken. Du bist jetzt bald fünfundsechzig ...“
„Einundsechzigeinhalb, bitte sehr!“
„Seien wir ehrlich und einigen uns auf die Mitte. Wie auch immer, du bist zu dick, die Fettwerte sind zu hoch, dein Herzkreislaufsystem wird vor der nächsten Jahreswende kollabieren, wenn du nichts unternimmst. Unternehmen heißt, du musst endlich anfangen, dich regelmäßig zu bewegen. Unternimm irgendwas, Menschenskind. Ich will gern noch ein paar Jahre diese weltbewegenden Gespräche mit dir führen und mein Wartezimmer Wartezimmer sein lassen ...“
„Du bist unmöglich!“
Gut. Damit war die Entscheidung gefallen. Ein Hund. Ein großer Hund. Schäferhunde mag ich nicht. Vor Doggen habe ich Angst. Also ein Bernhardiner.
Eine lebensverändernde Entscheidung. Wie sich jeden Tag von Neuem herausstellt.
Als wir am Ende unserer Runde am Pfarrhaus ankommen, legt Iwan wieder los. Und zieht mich hinter sich her. Er bellt wie angeschossen.
Diesmal hat er einen Grund.
Die Pfarrhaustür steht offen. Im Büro ist Licht.
Ich sehe auf die Uhr. Tagesschau gerade vorbei. Das kann nicht Frau Weimer sein. Mit ihren fünfundsiebzig Jahren muss sie längst ein wenig kürzertreten. Auch wenn sie nach wie vor, wie über viele Jahre, im Pfarrhaus und in der Kirche saubermacht. Ohne Bezahlung. Weil sie gern hier ist. Erst recht, seitdem sie allein ist nach dem Tod ihres Mannes. Sie schafft nicht mehr viel. Aber sie liebt es, mit mir und Marga Kleinschmidt zu frühstücken.
Frau Kleinschmidt kommt zweimal die Woche vorbei und hilft mir im Büro. Auch sie ohne Bezahlung. Das Landeskirchenamt hat seit Jahren alle Zahlungen für Verwaltungsangestellte und Reinigungsfachfrau eingestellt.
Die Gemeinde sei zu klein.
Obwohl schon vor zehn Jahren zwei weitere Dörfer zu meinem Pfarrbezirk hinzugekommen sind. Lutterfeld und Hemmstedt. Zwei Dreihundertseelendörfer. Zehn und fünfzehn Kilometer entfernt. Kein großer Spaß für meinen Arbeitsalltag.
Frau Weimer und Frau Kleinschmidt treffen sieben Tage in der Woche pünktlich morgens um neun Uhr im Pfarrhaus ein. Wenn nicht gerade Geburtstagsbesuche dazwischenkommen. Oder Synodensitzungen. Gottesdienste. Oder anderes Unaufschiebbare. Die beiden Engel sind jeden Morgen da. Um mit mir zu frühstücken. Zu klönen. Die neuesten Dorfnachrichten auszutauschen. Klatsch und Wichtiges.
Meine beiden Engel.
Vom dritten Engel, der langjährigen Rechnungsführerin Elisabeth Bothe, mussten wir uns schon Mitte der Neunzigerjahre für immer verabschieden. Sie hat, hoch in den Siebzigern, einen Herzinfarkt nicht überlebt.
In unseren morgendlichen Frühstücksgesprächen ist sie lebendig. Wir vermissen sie.
Ich genieße diese „Dienstfrühstücke“.
Frau Weimers Mann ist vor sieben Jahren verstorben. Und Frau Kleinschmidt hat sich ein Jahr später von ihrem Mann getrennt.
Die beiden genießen diese Begegnungen genauso wie ich. Nicht den ganzen Tag allein im Haus.
Mittlerweile hat mich Iwan bis zur Pfarrhaustür gezogen. Er kriegt kaum Luft, keucht und hustet und bellt, alles durcheinander. Aber er lässt sich nicht abhalten, seiner Empörung Ausdruck zu verschaffen.
Es hat eine Veränderung gegeben. Es ist nicht alles wie immer. Geht gar nicht.
Allerdings: Diesmal teile ich seine Meinung.
„Hallo, Pastor.“ Knut Scheinhaus grinst süffisant.
Seit den Zeiten seines Großvaters Wilhelm Scheinhaus hat sich die Großgrundbesitzerfamilie vor Ort vorbehalten, einen Schlüssel zu den kirchlichen Gebäuden zu besitzen. Ich habe mehrere Male im Kirchengemeinderat dagegen opponiert. Die Mehrheitsmeinung bleibt. Als Patron der Kirche in Groß Samtleben hat das Familienoberhaupt Scheinhaus in der Ausübung seines Patronatsrechts Zugang zu den kirchlichen Gebäuden.
Mich ärgert das maßlos. Seit Jahren.
Außerdem ärgert mich, dass ich mich bei einem feuchtfröhlichen Abend auf dem Schützenfest vor gefühlt einer Ewigkeit darauf eingelassen habe, dass wir uns duzen.
„Was willst du, Knut?“ Ich habe keine Lust auf Höflichkeit. Knut Scheinhaus weiß genau, dass es mich zur Weißglut bringt, wenn er unangemeldet und ohne von mir eingelassen zu werden ins Pfarrhaus eindringt.
„Guten Abend, lieber Knut, wie schön, dich wiederzusehen, heißt das. Versuch’s doch mal mit Freundlichkeit.“
Knut hält mir einen prall gefüllten Plastikbeutel vor die Nase. Iwan beruhigt sich sofort. Er schnuppert, wedelt mit dem Schwanz, winselt froh. Ich kann gerade noch verhindern, dass er Knut anspringt und ihm seine riesigen Tatzen auf die Schultern legt.
Das ist sein morgendliches Begrüßungsritual mir gegenüber. Mit der Fortsetzung, dass er mein Nachthemd vollsabbert. Ich akzeptiere das als Liebeserklärung.
Bei Fremden kann ich das allerdings nicht haben.
Nicht in meinem Haus.
Genauer gesagt, überhaupt nicht.
„Ich bin gerade vorbeigekommen und dachte, ich bring dir Pansen vorbei. Dann brauchst du nicht extra rauszukommen.“
Pansen bekomme ich am sichersten im landwirtschaftlichen Großbetrieb Scheinhaus. Einfach weil hier die meisten Rinder stehen. Massentierhaltung halt.
Iwan liebt Pansen. Besonders wenn der schon ein bisschen gammelig ist und stinkt, wenn ich ihn zuschneide.
Ich beschließe, die Strategie zu ändern. „Schön, dass du da bist, Knut. Danke für die Mahlzeit. Willst du was trinken?“
„Klar doch. Aber nicht diesen ewigen Bushmills, wenn‘s recht ist. Hast du noch was von diesem leckeren Tomatin Legacy?“
Ich schlucke. Weihnachtsgeschenk meiner beiden Engel. Dusseligerweise habe ich ihm irgendwann mal einen Schluck angeboten. „Klaro. Ich hol’ die Flasche. Komm mit, Iwan.“
Iwan krabbelt bereitwillig schwanzwedelnd und schnuppernd hinter mir die Treppe hoch. In der Küche schneide ich ihm schnell ein Stück Pansen zurecht und gebe es in seinen Fressnapf. Er fängt sofort an, wohlig zu schmatzen. Ich schnappe mir den Edelwhiskey aus dem Regal in meinem Arbeitszimmer und gehe wieder nach unten ins Gemeindebüro.
Der Patron steht am Aktenschrank und blättert in Papieren. Anscheinend hat er die Haushaltsabrechnung entdeckt. Ich konzentriere mich darauf, ihn nicht anzuschreien.
„Komm, setz dich.“ Ich gieße uns beiden einen doppelten Fingerbreit ein. Er quittiert das mit zufriedenem Lächeln.
Er nestelt in seiner Jacke. „Cohibas. Willst du? Kriegst du nicht alle Tage!“
Natürlich will ich. Lange Zeit wurden diese Havanna-Zigarren ausschließlich für den Gebrauch von Fidel Castro produziert.
Ist schon ein mächtig edles Zeug.
Wir rauchen. Wir trinken. Ich warte ab.
Nach drei Minuten – eine endlos lange Zeit, wenn niemand etwas sagt – wird es mir zu bunt. „Und? Du machst dich doch nicht am späten Abend auf den Weg, bloß um Iwan mit Pansen zu versorgen. Was willst du?“
Knut fixiert mich. Er lässt sich Zeit. „Wann ist Kirchengemeinderatssitzung? Morgen Abend, wenn ich richtig informiert bin?“
„Warum fragst du, wenn du es sowieso weißt?“
Er zieht genüsslich an der Zigarre und nimmt einen ordentlichen Schluck.
„Und die Verpachtung des Pfarrlandes steht auf der Tagesordnung?“
Daher weht also der Wind. Hätte ich mir denken können. Ich schweige.
„Du weißt, dass die Gemeinde ohne die beständigen freundlichen Zuwendungen aus unserem Haus längst bankrott wäre?“
Ich sage nichts. Natürlich hat er recht. Das größte Problem ist, dass das Pfarrhaus – mitsamt den Gemeinderäumen – in den letzten fünf Jahren eine Baustelle war. Die Wände waren nass, sie mussten aufwendig trockengelegt und Horizontalsperren eingezogen werden. Die Verteilung der Kostenübernahme zwischen Gemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche ist strittig. Wenn der Patron nicht von Anbeginn anstandslos Kredite vergeben hätte – allerdings zu saftigen Konditionen –, hätten wir alle Gemeindeaktivitäten schon längst für unabsehbare Zeit aufgeben müssen.
Ich warte ab. Ich weiß sowieso, was jetzt kommt. Er soll mir das wenigstens selber unterbreiten.
„Ich gehe davon aus – ach was, ich verlange, dass die gesamte zu verpachtende Fläche zuerst meinem Betrieb angeboten wird. Haben wir uns verstanden?“
Ich schweige weiter. Lasse ihn zappeln. Er wird unruhig.
Es ist skandalös, was er da fordert. Ich werde das auf keinen Fall zulassen.
Seit den Sechzigerjahren haben in den vier Dörfern, die zur Kirchengemeinde hinzugehören, bis auf sechs Höfe alle landwirtschaftlichen Betriebe aufhören müssen.
Überlebt haben: Der Großgrundbesitz der Familie Scheinhaus. Dann drei „völkische“ Höfe mit insgesamt fünfzehn Kindern. Sie geben sich selbst als ökologisch orientierte „bäuerliche Landwirtschaft“ aus.
Was von den zwei Öko-Landwirtschaftsbetrieben in den Dörfern massiv bestritten wird. Sie sind politisch eher fortschrittlich, leiden aber aktuell genauso wie alle Nicht-Großgrundbesitzer an einem Paniksparstreich der neoliberal dominierten Ampelregierung in Berlin. Die Subventionierung von Agrardiesel soll gestrichen, schließlich nach massiven bäuerlichen Protesten über Jahre gestreckt – und damit immer noch gestrichen werden.
Für die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe ist das existenzbedrohend. Dabei wissen alle, dass diese Subventionen die eigentlichen Probleme der Landwirtschaft nur verdecken. Vor allem die Marktmacht der Supermarktketten, die die Preise diktieren und das Wirtschaften für viele landwirtschaftliche Betriebe unauskömmlich machen.
Die beiden Ökobauern stehen kurz vorm Aufgeben. Die Völkischen haben zusätzliche Ressourcen aus den Parteizentralen und von faschistischen Großunternehmern.
Alle landwirtschaftlichen Betriebe sind auf zusätzliche Ackerflächen angewiesen. Allein schon deshalb, weil die staatlichen Subventionen an die Flächengröße gebunden sind.
Alle paar Jahre wird über eine Neuverpachtung des Pfarrlandes entschieden.
Würde die Gemeinde das gesamte landwirtschaftlich nutzbare Land in ihrem Besitz – und das ist mit neunhundert Hektar nicht wenig – an den Großgrundbesitzer verpachten, dann würde das die Existenz der beiden ökologisch orientierten landwirtschaftlichen Betriebe weiter untergraben. Und nicht zuletzt den Faschisten in den „völkischen“ Höfen in die Hände spielen.
Knut Scheinhaus weiß das. Vielleicht will er das.
„Und? Bist du eingeschlafen? Sind dir die Cohibas auf den Magen geschlagen? Macht dich jetzt schon ein kleiner Schluck von deinem Edelwhiskey in deinem hohen Alter besinnungslos?“
Ich mache ihm die Freude und lache über sein Witzchen.
„Der Kirchengemeinderat wird dein Anliegen sorgfältig beraten und entscheiden.“
„Ist das alles?“
Ich trinke einen letzten großen Schluck und drücke die erst halb gerauchte Havannazigarre im Aschenbecher aus. Ich bemerke seinen Ärger. Ich freue mich darüber.
„Du weißt, dass ich über diese Dinge nicht allein entscheiden kann. Ich sichere dir zu, dass ich dein Anliegen vortragen werde.“
„Und wirst du dafür plädieren?“
Ich lächle freundlich. Er ist mittlerweile aufgestanden. Erregt.
„Schau’n wir mal.“
Ich wälze mich im Bett. Ich habe höchstens drei Stunden geschlafen. Kann nicht wieder einschlafen.
Ich habe wild geträumt. Und jetzt dieses quälende Gedankenkarussell.
Der Traum ist ein Tagesrest. Oder besser, ein Wochenendrest. Die letzte Sitzung der Landessynode ist vor vier Tagen zu Ende gegangen. Ich bin Mitglied. Bestimmt schon seit zehn Jahren. Synodensitzungen dauern drei Tage und sind einigermaßen anstrengend. Manchmal wird es schwer erträglich. Nicht wegen der diskutierten Gesetze oder anderer Inhalte.
Schwer erträglich ist, was in den vorderen Sitzreihen los ist. Da sitzen die kirchenleitenden Persönlichkeiten.
Da herrscht Eiszeit. Schon seit Monaten.
Die drei wichtigsten Machtfiguren der Braunsruher Landeskirche können sich nicht leiden.
Nein, das ist untertrieben. Sie sitzen drei Tage nebeneinander, wechseln kein Wort, gucken sich mit dem A... nicht an.
Drei Männer, die konkurrieren. Und die sich mittlerweile auf den Tod nicht ausstehen können. Die ihre Feindschaft unverhohlen vor der gesamten Synode zelebrieren.
Der Landesbischof. Kai Grübner.
Der Präsident der Synode. Ulrich Mesche.
Der Präsident des Landeskirchenamtes, zugleich Chef der Finanzabteilung der Landeskirche. Karl Flohsinn.
Die drei sind nicht mal „schuld“ an der Misere. Im Hintergrund steht ein ungelöstes Problem der Kirchenverfassung. Der Landesbischof hat eigentlich die Leitung des „Kollegiums“, also der Kirchenregierung. Er ist damit symbolisch in der stärksten Machtposition.
Nicht jedoch faktisch.
Vor allem der Präsident des Landeskirchenamtes macht in jedem seiner Redebeiträge deutlich, dass ohne ihn, also ohne den Leiter der gesamten Kirchenverwaltung der Landeskirche und Chef der Finanzen überhaupt nichts geht. Theologische Überlegungen, in denen der Landesbischof brilliert, interessieren ihn nicht.
Mich nervt das. Ich halte das Verfassungsproblem für lösbar. Die Machtverteilung muss verfassungsrechtlich eindeutig bestimmt werden. Das geht mit Zweidrittelmehrheit der Synode. Nach all den Nervereien mit diesem Machtkampf, den alle Synodalen Tag für Tag miterleben, findet sich diese Zweidrittelmehrheit mit Sicherheit.
Das ist aber nicht der Punkt, der mich nicht schlafen lässt.
Ich mache mir ernsthaft Sorgen um den Landesbischof.
Zugegeben, ich bin parteilich.
Der Landesbischof ist einer meiner Schützlinge. Er war mein jugendlicher Mitarbeiter bei einer ganzen Reihe von Konfirmandenferienseminaren in Südtirol. Über viele Jahre. Ich habe ihn während seines Theologiestudiums und Vikariats immer wieder begleitet. Der Kontakt ist auch später nicht abgerissen. Kai ist nach und nach vom jugendlichen Mitarbeiter zum erwachsenen Freund geworden. Wir sind verbunden geblieben, als er in der Landeskirche die Karriereeiter hochkletterte.
Vor einem Jahr ist er zum Landesbischof gewählt geworden.
Und seit fast einem Jahr in diesen nicht enden wollenden Konflikt verstrickt.
Ich habe Kai in seiner beruflichen Karriere begleitet. Aber auch als Seelsorger in seinen persönlichen Konflikten.
Darüber will ich gerade nicht nachdenken.
Ich stehe auf und stolpere in die Küche. Iwan ist in seinen Korb umgezogen und japst im Traum. Wahrscheinlich verspeist er gerade ein zwei Quadratmeter großes Stück Pansen.
Ich gieße mir drei Finger breit Whiskey ein.
Ich weiß. Das hilft nicht beim Einschlafen.
Kein Whiskey hilf allerdings auch nicht.
Während der beiden letzten Synodensitzungen sind seltsame Dinge passiert.
Die Reifen des bischöflichen Dienstwagens waren zerstochen, als der Fahrer von seiner Mittagspause im Currywurstimbiss zurückkehrt.
Der Aktenstapel auf dem Synodenplatz des Synodenpräsidenten, den er für einen wichtigen Haushaltsbericht braucht, verschwindet während der Mittagspause.
Außerdem fällt das Saalmikrofon ständig aus, wenn der Präsident der Synode redet.
Kleinigkeiten?
Jedenfalls ist die Synode not amused über die Gesamtsituation. Ich auch nicht.
Ich bin lange Mitglied der Landessynode. Das macht im Grunde Spaß. Vor allem wegen zweier interessanter Menschen, die ich da kennengelernt habe.
Ich bringe für die dreitägigen Synodensitzungen immer eine Flasche Whiskey mit. Für die Abendentspannung. Oft tagen wir bis elf Uhr abends. Wir sind dann in der Regel müde und entnervt. Wenn das Schlussgebet gesprochen ist, brennt das wilde Leben los. Alle stürmen in die Kneipe unten in dem Hotel, wo wir tagen und übernachten. Möglichst schnell möglichst viel Alkohol. Möglichst schnell nette Meschen treffen, mit denen man noch ein wenig klönen kann.
Ich mag diese Rituale. Ich habe eine private Vorglühparty in meinem Hotelzimmer ins Leben gerufen. Es sind immer dieselben, die ich einlade. Markus Bader und Paul Schück. Wir sitzen seit bestimmt fünf Jahren im Plenum. Bei Kaffeepausen haben wir uns kennengelernt. Einander sympathisch gefunden. Sind ins Quatschen gekommen. Die Idee mit dem Whiskey kam mir bei einem Kaffeegespräch, als wir uns über unsere Lieblingsgetränke ausgetauscht haben. Einhellige Vorliebe: irischer Whiskey. Das gab den Ausschlag. Seitdem verbringen wir jeweils die erste halbe Stunde unserer nächtlichen Synodenpause auf dem Balkon meines Hotelzimmers. Kommentieren das Tagesgeschehen. Rauchen Zigarillos. Trinken Whiskey.
Beim letzten Mal haben wir uns massiv in die Wolle gekriegt.
Markus und Paul können meine Parteilichkeit für den Landesbischof nicht hinnehmen. „Der mischt doch genauso mit bei dem Desaster wie die beiden anderen.“
Ich finde keinen Schlaf.
Okay, ich will jetzt nicht weiter drüber nachdenken.
Nach zwei weiteren Stunden habe ich die Nase voll und ziehe um ins Arbeitszimmer.
Iwan ist schon wieder schlafgewandelt. Ich schlage fast lang hin, als ich über ihn stolpere. Er hat sich vor der Tür meines Schlafzimmers zusammengerollt. Winselt im Traum. Zum Glück wacht er nicht auf.
Ich hole mir ein weiteres Glas aus der Küche und gieße mir drei Fingerbreit Bushmills ein. Ich nehme die Flasche mit.
Den trinke ich genauso gern wie dieses Edelgesöff. Ich hole mir eine Decke und kuschele mich auf dem Schreibtischstuhl ein.
Es ist dunstig draußen. Aber nicht bewölkt. Ich kann von meinem Platz aus die wunderschöne Barockkirche gut sehen.
Dieses Ensemble, ach was, dieses Dorf, überhaupt „meine“ vier Dörfer sind mir Heimat geworden. Das hätte ich mir in den ersten Jahren in dieser Gemeinde, in der Wendezeit nach 1989, kaum vorstellen können.
Warum bin ich eigentlich hiergeblieben? All die Jahre? Faktisch mein gesamtes Berufsleben?
Ich nehme einen großzügigen Schluck. Es tut gut, wie die Glieder langsam matt werden.
Sicher war das existenzielle Faulheit. Zumindest zu einem erheblichen Anteil.
Nein, Quatsch, das stimmt nicht.
Die Menschen hier sind mir ans Herz gewachsen.
Ich trinke das Glas leer und gieße mir nach.
Weil ich nie eine Familie gegründet habe? Vielleicht ja. Die Leute hier sind mir zur Ersatzfamilie geworden, in all ihren Schrägheiten und Konflikten, in ihrer Alltagsweisheit und ihrer Liebenswürdigkeit.
Warum habe ich nie geheiratet? Wo ich doch geschätzt Hunderten junger Paare in Traugottesdiensten den Segen Gottes für ihr Zusammenleben zugesprochen habe?
Der wichtigste Grund ist vermutlich Anne. Anne Hartmann. Polizeikommissarin und Leiterin der Mordkommission in Salzgitter Lebenstedt, dann über zwanzig Jahre bis zu ihrer Pensionierung in Braunsruh. Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke: Sie ist die Liebe meines Lebens.
Bloß: Sie konnten beisammen nicht kommen.
Dabei glaube ich, dass auch sie mich liebt. Aber es nie geschafft hat, die Verletzungen, die ihr in anderen Liebesbeziehungen zugefügt wurden, so weit in ihr Leben zu integrieren, dass sie für eine neue Beziehung offen wurde.
Für eine Beziehung zu mir.
Ich schlage die Hände vors Gesicht.
Eigentlich eine todtraurige Lebenssumme. Jetzt bin ich dreiundsechzig. Und es wird sich nichts mehr ändern in meinem Leben.
Noch ein Schluck. Tut mir gut. Draußen, gegenüber im Kirchturm, setzt sich das Läutewerk in Bewegung. Sechs Uhr morgens. Über Nacht lassen wir die Leute im Dorf schlafen und stellen das Gebimmel zu allen halben und vollen Stunden ab.
Immerhin haben wir eine Form gefunden, miteinander in Kontakt zu bleiben.
Ab und an ein gemeinsamer Fernsehabend.
Und: seit ihrer Pensionierung Doppelkopf. Zusammen mit Markus Bader und Paul Schück.
Anne Hartmann lebt jetzt in Salzgitter Thiede und arbeitet – als Hobby, nicht mehr im Amt – liegen gebliebene Mordfälle auf.
Ich muss jetzt unbedingt wieder ins Bett. Wenigsten noch ein Stündchen schlafen.
2
„Aufwachen, Alterchen.“ Ich habe mir schon einen ersten Kaffee aufgesetzt und für Iwan Pansen kleingeschnitten und Wasser in den Napf gefüllt. Ich kraule ihn hinter den Ohren. Er wälzt sich auf den Rücken, damit ich ihn am Bauch kraulen kann. Das liebt er.
„Komm, wir gehen einkaufen!“
Aber erst wird ein kleiner Snack verspeist. Vor dem eigentlichen Frühstück. Damit wir beide zu Kräften kommen.
„Wir gehen einkaufen“ – diese Parole macht erst seit einem halben Jahr wieder Sinn.
Über viele Jahre ist im Dorf ein Geschäft nach dem anderen eingegangen. Gegen die Supermärkte in Lebenstedt hatten die Dorfläden keine Chance. Nacheinander haben alle dichtgemacht. Die Schlachterei. Der Lebensmittelladen. Die Tankstelle.
Schließlich auch Bei da Nino, die Pizzeria. Nino ist mit seiner Familie nach Süditalien zurückgegangen.
Seit zwei Jahren ist er wieder da. Mittlerweile in den Siebzigern. „Ihr braucht uns doch, Herr Pastor. Unser wunderbares Groß Samtleben.“ Allerdings hat er ein eigenes Restaurant nicht wieder eröffnet.
Zum Schluss hat der „Brotladen“ zugemacht, lange Zeit Kommunikationsbörse des Dorfes. Solange es noch kein Internet gab.
Das Dorf hat dieser Entwicklung Jahr für Jahr zunehmend deprimiert zugesehen. Wer ein Auto hat, kann sich ein paar Kilometer weiter im Supermarkt versorgen. Für die Armen und die Alten wurde es immer schlimmer. Zweimal in der Woche kommt ein Verkaufswagen. Der hält aber nur an wenigen Orten. Die Alten sind oft zu langsam, wenn sie denn überhaupt das Gebimmel hören, mit dem dieser fahrbare überteuerte Kramladen sich ankündigt. Wenn sie vor Ort sind, ist der Wagen oft schon wieder weg.
Das ging nicht so weiter.
Unsere Schulleiterin Amalie Mischke hat den Anstoß gegeben. Die Feuerwehrjugend war sofort Feuer und Flamme. Drei von den Landwirtsfamilien, die ihre Höfe aufgegeben haben, fanden endlich wieder eine Beschäftigung vor Ort. Verrentete Verwaltungsangestellte. Erwerbslos gewordene Handwerker. Eine ganze Reihe VW-Beschäftigter, die ihre Jobs verloren haben.
Wir haben eine Genossenschaft gegründet. Damit die Rechtsform geklärt ist. Ein Rechtsanwaltsbüro in Lebenstedt, das in diesen Fragen engagiert ist, hat sich als Besitzer eintragen lassen. Abgesehen davon arbeiten alle Beteiligten ehrenamtlich.
Ich selbst bin von Anfang an dabei. Und habe meine Kontakte spielen lassen. Eine studierte Betriebswirtin in Salzgitter Bad. Ein Steuerberater aus Lichtenberg. Fast alle ökologischen landwirtschaftlichen Betriebe in der näheren Umgebung. Immerhin neun Höfe. Die Prokuristen zweier Supermärkte in Lebenstedt. Das ist rein mengenmäßig der wichtigste Posten. Genießbare Lebensmittel kurz vor und nach dem Verfallsdatum.
Es hat schon Vorteile, wenn man fast die ganze Gegend verheiratet hat.
Ein Jahr Planungszeit. Immer mehr Leute aus unseren vier Gemeinden sind dazugekommen. Der ehemalige „Brotladen“ wurde angemietet, die Mauern zwischen Verkaufsraum und Backstube niedergelegt. Wochenlanger Einsatz auf der Baustelle. Auch die Konfirmandenkurse hatten die Chance, praktische Übungen zu biblischen Texten mitzumachen. „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.“ (Psalm 118,22)
Dann, vor fast genau fünf Monaten, die feierliche Eröffnung. „Wir bleiben hier“, der Name für unseren Tante-Emma-Laden wurde nach endlosen Debatten mit allen Beteiligten abgestimmt.
Der Name ist ohnehin gut. Und wir haben ihn von den Rechten gekapert.
Zur feierlichen Eröffnung hat der Landesbischof eine launige Rede gehalten. Der hat nie vergessen, dass er aus unserem Dorf kommt. Auch nicht, als er vor einem Jahr von der Landessynode gewählt wurde.
Nicht nur mit mir ist er verbunden geblieben. Mit einigen im Dorf. Wir sind über die Jahre enge Freunde geworden. Mehr als das.
„Wir bleiben hier“ hat jede Woche an drei Vormittagen und drei Nachmittagen geöffnet. Es gibt fast alles zu kaufen. Jedenfalls an Lebensmitteln. Ökologisch und preiswert. Wir teilen uns die Schichten im Verkauf. Ich bin einen Nachmittag pro Woche für eine Vierstundenschicht vor Ort.
Aber nicht heute morgen. Heute bin ich Kunde. Iwan wird mit großen Hallo begrüßt und von den anwesenden jungen Leuten gekuschelt. Er lässt sich alles brav gefallen. Er kennt das schon. Ich besorge Brötchen und Käse für die Frühstücksrunde.
Heute bleibe ich nicht für einen Klönschnack. Ich bin etwas spät dran.
Iwan will mal wieder nicht los. Ich versuche ihn zu überreden. Schließlich überlasse ich ihn Britta, einer erwerbslosen jungen alleinerziehenden Mutter, die gerade Schicht hat. Das haben wir schon öfter so gemacht. Iwan hat sich aus irgendeinem Grunde in Britta verliebt.
Bei ihr hat er auch seinen Dachschaden besser unter Kontrolle und schafft es ohne Tobsuchtsanfall, an Autos vorbeizukommen, die beim letzten Spazierweg noch nicht an der gleichen Stelle geparkt haben.
„Ich bringe ihn nachher vorbei.“
„Sie sollen sich doch nicht so anstrengen!“ Frau Weimer stellt den Wischeimer in die Ecke. Sie ist aus der Puste. Sie setzt sich an den Frühstückstisch, kommt langsam zu Atem. Nimmt einen großen Schluck Kaffee. „Weiß ich doch. Bloß mich stört, wenn was liegen bleibt.“
„Wenn Sie nicht auf sich achthaben, müssen Sie drei Tage in den Zwangsurlaub.“ Frau Kleinschmidt guckt betont streng. Ich muss lachen.
„Sie hat schon recht.“
Frau Weimer schmollt. Aber nicht ernsthaft.
Dann fällt ihr was ein. „Ich weiß schon, wie Sie mich entlasten können.“
Ich sehe sie erwartungsvoll an.
„Ich will dieses Ungetüm nicht mehr entstauben. Dieses Plastikmonster. Diesen überdimensionalen Staubfänger.“
Frau Kleinschmidt prustet los. „Gibt es eigentlich irgendwen in der Gemeinde, der mit diesem Ding was anfangen kann?“
Ich hole tief Luft. „Das Ding“ ist eine überdimensionierte Lutherfigur aus Plastik. Vor einigen Jahren war das mal eine Kunstaktion. Ein Aktionskünstler namens Ottmar Hörl hat achthundert Plastik-Luther produziert und in Wittenberg im öffentlichen Raum verteilt. Nach und nach wurden die verkauft.
Unser Patron und Großgrundbesitzer Knut Scheinhaus hat es sich nicht nehmen lassen, eine Lutherfigur zu erwerben und der Kirchengemeinde Groß Samtleben zu spenden.
Mit der Auflage, dass die Figur einen prominenten Platz erhält.
Am liebsten über der Kanzel im Kirchenraum. Da bläst aber schon ein barocker Holzengel in seine Trompete.
Also im Versammlungsraum im Gemeindehaus. In der Ecke, wo das Rednerpult steht. Über dem Kopf des jeweiligen Redners. „Damit klar wird, dass der Redner im Namen unseres Reformators spricht.“
Was für ein Quatsch. Ich kenne keinen in der Gemeinde, der dieses Monster leiden kann. Ich habe in mehreren Kirchengemeinderatssitzungen dafür geworben, das Teil zu entsorgen.
Keine Chance. „Das ist ein Geschenk. Geschenke werden nicht entsorgt.“
„Das hat uns unser Patron gespendet. Als Zeichen seiner Verbundenheit.“
„Es macht doch Sinn, die Redner daran zu erinnern, in wessen Namen sie sprechen ...“
Kurz und gut, das Monster bleibt.
„Ich finde, das ist eine richtig gute Idee.“ Frau Kleinschmidt kichert. „Wenn der Reformator erstmal so richtig verstaubt ist, dann haben wir bessere Chancen, den Raum neu zu gestalten. Ohne überdimensionierten Plastikmüll. Ich habe auch schon ein paar Ideen ...“
„Abgemacht.“ Ich reiche Frau Weimer die Hand. „Ab heute dürfen sie das Ding mit voller Unterstützung von Pastor und Gemeindesekretärin verrotten lassen!“ Frau Weimer füllt die Kaffeetassen auf, damit wir was zum Anstoßen haben. „Abgemacht!!!“
„Das ist doch auch ohne Entstaubung des Plastik-Luthers großartig, was Sie alles für uns machen. Aber bitte so, dass wir noch ein paar Jahre was von Ihnen haben. Vielleicht fällt Ihnen ja noch mehr ein, was Sie weglassen können ...“
„Ach, Herr Pastor. Das müssen gerade Sie sagen.“
Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, meinen beiden Engeln den „Herrn Pastor“ abzugewöhnen. Wir kennen uns jetzt seit fünfunddreißig Jahren, sehen uns jeden Tag und haben einiges miteinander durchgemacht.
Nichts zu machen. „Lassen Sie mir doch den Spaß. ‚Herr Bentorff‘ will mir nicht über die Lippen. Oder soll ich Sie Lukas nennen?“
„Warum nicht?“
„Nun machen Sie mal halblang. Wir sind unser halbes Leben gut miteinander ausgekommen. Wollen Sie jetzt etwa ...“
Ich nehme ihre Hand. „Nein, es soll alles bleiben, wie es ist. Ich bin von Lebewesen umgeben, für die das am wichtigsten zu sein scheint im ganzen Leben ...“
„Wollen Sie uns etwa mit Iwan vergleichen?“ Frau Kleinschmidt macht auf empört. Sie muss lachen. „Ach was, wir kommen so oder so gut miteinander aus. Haben Sie schon vom neuesten Drama gehört?“
Frau Weimer gießt allen Kaffee ein. Gesprächspause. Brötchen werden geschmiert, der Aufschnitt probiert, die erste Tasse Kaffee ist schnell leer.
„Was ist denn?“
„Ach, es gibt Ärger mit den Ukrainern. Im Dorf ärgert das viele. Klar, sie haben schwere Schicksale hinter sich, oft alles verloren, oft genug auch liebe Menschen. Aber das haben die Leute aus Afghanistan oder Syrien auch. Wieso kriegen die Ukrainer alles und die anderen Flüchtlinge nichts? Drei Häuser im Dorf von der Gemeinde angemietet und umsonst bereitgestellt. Alles sofort. Aufenthaltserlaubnis. Arbeitserlaubnis.“ Frau Kleinschmidt redet sich in Rage. „Die Politiker in Berlin tun so, als seien die gar nicht da. Als sei mit der Abschiebung von ein paar hundert Menschen aus Afghanistan das Flüchtlingsproblem gelöst. Aber vor Ort kriegen alle mit, was in den Kindergärten los ist. In den Schulen. Das sind nicht die Kinder aus Kabul. Oder aus Eritrea. Das sind die Kinder aus Kiew oder Charkiw oder Odessa. Für die muss jetzt alles umgestellt werden ...“
„Wieso gibt es Ärger? Ich kann mir kaum vorstellen, dass unsere Leute im Dorf wollen, dass die Geflüchteten aus Syrien die gleichen Rechte bekommen ...“
„Natürlich nicht. Aber ich will das. Ich finde, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit.“
„Das finde ich auch.“
Frau Weimer räuspert sich, sagt aber nichts. Sie ist anderer Meinung, ich weiß das. Sie ist der Stimmung im Dorf stärker verpflichtet als Frau Kleinschmidt. Oder ich selbst.
Wobei ich nach vielen Gesprächen bei Geburtstagsbesuchen den Ärger der Leute gut verstehen kann.
„Ist was vorgefallen?“
„Nein, nicht wirklich. Oder noch nicht. Die ukrainischen Leute verhalten sich ungeschickt. Mindestens das. Die Erwachsenen lernen kein Deutsch. Weil sie sowieso nicht hierbleiben wollen. Sie grüßen nicht auf der Straße, auch wenn sie gegrüßt werden. Das kannst du nicht machen auf dem Dorf. Außerdem haben sie bis spät in die Nacht das Fenster offen, auch bei diesen Temperaturen. Sie sind laut, zumindest die Männer. Man hat das Gefühl, obwohl niemand einen Ton versteht, dass ständig Streit ist. Die Männer trinken. Wenn sie telefonieren, dann brüllen sie ins Telefon, als ob ihre Leute in Charkiw sie ohne Telefon hören können. Und die jungen Mädels hängen tagsüber aus dem Fenster und putzen sich raus, damit jeder vorbeifahrende Motorradfahrer eine Vollbremsung macht und ins Glotzen kommt ...“
„Sie übertreiben ...“
„Nein, sie übertreibt nicht.“ Frau Weimer hat zunehmend erregt zugehört. Sie ist richtig böse. „Wenn diese Leute so weitermachen, dann wird was Schlimmes passieren. Ich spür’ das. Und ich mach’ mir richtig Sorgen.“
Es klingelt Sturm. Wir sehen uns besorgt an. „Wie auf Bestellung ...?“
Frau Kleinschmidt geht an die Tür. Ich höre aufgeregte Stimmen. Frau Kleinschmidt kommt zurück, hinter ihr ein paar Jungs aus der Jugendfeuerwehr. „Seid ihr nicht in der Schule?“
„Die ganze Woche Berufsvorbereitungspraktikum. Sie müssen mitkommen, Herr Pastor.“
Das ist Lars Viersen. Ich kenne ihn aus dem Konfirmandenunterricht. Er hat sich verändert. Groß, blond, durchtrainiert. Mit seinem Großvater hatte ich damals ziemlich Ärger. Er war Vorsitzender der Lustigen Jecken Groß Samtleben. Einer der beiden Karnevalsvereine im Dorf. Otto Viersen hatte damals keinen Hehl aus seiner Verbundenheit mit dem untergegangenen Nationalsozialismus gemacht. Er schwärmte für die Wehrwölfe, eine Kampftruppe der Waffen-SS, die auch nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 weitergekämpft hat. Sein Sohn Hermann, Vater von Lars, ist heute Vorsitzender des Ortsverbandes Salzgitter West der AfD. Wie sich Lars nach dem Konfirmandenunterricht weiterentwickelt hat, habe ich nicht mehr mitverfolgt.
Die anderen jungen Männer erkenne ich erst nach und nach. Seit dem Konfirmandenunterricht habe ich sie nicht mehr wiedergesehen.
Lars lässt keinen Zweifel, dass es dringend ist. Ich ziehe mir die Doc Martens an und werfe Schal und Lederjacke über.
Die beiden Engeln haben die Situation aufmerksam verfolgt. „Können Sie sich bitte um Iwan kümmern? Britta Mahlke will ihn nachher vorbeibringen.“
„Na klar. Sie haben ja nicht mal Ihr halbes Brötchen aufgegessen, Herr Pastor ...“
Die Jungs rennen fast. Ich komme aus der Puste. „Langsamer, bitte! Ich bin ein alter Mann!“ Nach zehn Minuten sind wir in der Siedlung. Die drei von Ukrainern bewohnten Häuser liegen direkt nebeneinander. Im rechten Haus, der kleinsten, etwas schäbigen Behausung, sind drei Fensterscheiben zerschlagen. Eine Tür hängt in den Angeln. Ein dunkelhaariger junger Mann, kräftig wie ein Boxer, lehnt in der Tür. Seine Augenbraue blutet. Er hat ein Schrotgewehr bei sich. Ab und zu zielt er auf die Menschenmenge vor dem Haus.
Das sind fast ausschließlich junge Männer. Einige in Feuerwehruniform.
Anscheinend ist keiner von denen heute beim Berufsvorbereitungspraktikum aufgeschlagen.
Die Gruppe ignoriert den Mann mit dem Gewehr. Sie haben einen Kreis um zwei ihrer eigenen Leute gebildet. Die sind in ihren Gesichtern verletzt. Teilweise mit Armbinden. Mit Pflastersteinen bewaffnet und offensichtlich auf hundertachtzig. Verzerrte Gesichter. „Deutschland den Deutschen!!!“, grölt der eine. „Weg mit den Ostvölkern aus unserem Land!!!“
„Lass den Quatsch, Erwin. Lass den Stein los. Red nicht so einen Quark.“ Das ist Lars.
Alle Achtung. Er hat sich offenbar nicht von seinem Großvater oder seinem Vater anstecken lassen, was die politische Einstellung angeht.
Es kommt zum Handgemenge. Den beiden werden die Pflastersteine entwendet. Die Mehrheit der Feuerwehrjugend ist jedenfalls nicht auf Krawall gebürstet.
Ich stelle mich zwischen die Gruppe und den Mann mit der Flinte. „Legen Sie das Gewehr beiseite!“ Er guckt mich verständnislos an. Ich gehe langsam auf ihn zu. „Legen Sie die Waffe weg!“
Er hebt das Gewehr und zielt auf meinen Kopf. Anscheinend versteht er kein Deutsch.
Aus dem Nachbarhaus stürzt eine junge Frau und kommt auf uns zugerannt. Sie schreit dem Bewaffneten auf Ukrainisch ein paar Satzfetzen zu. Er senkt die Flinte. „Pass auf dich auf, Tanja!!!“ Das kommt aus der Feuerwehrjugend.
Ich drehe mich um. Lars sieht besorgt aus.
Die mit „Tanja“ angeredete Frau fällt dem Bewaffneten in den Arm. Der will die Flinte nicht freigeben. Ein Schuss löst sich. Die junge Frau hält sich schreiend den Fuß. Jetzt kommt Bewegung in die Szene. Aus allen drei Häusern kommen Männer herausgerannt und bringen den Schützen zu Fall. Sie drücken ihn auf die Erde und halten ihn fest.
Die Jugendlichen sind wie erstarrt. Ihr Handgemenge ist vergessen.
Ich schreie Lars Viersen an, dass er 112 wählen und einen Notarzteinsatz herbeordern soll.
Dann schnappe ich mein Handy und rufe bei der Polizei in Salzgitter an.
Mordkommission.
Der Nachfolger von Anne Hartmann ist mir nicht sympathisch. Ich habe ein paar seiner Auftritte im NDR angesehen, als er berufen worden ist.
Jung, karrieristisch, hartgesotten, kompetent.
Ich bin voreingenommen. Weiß ich.
„Hering hier, Mordkommission Salzgitter.“
Jetzt bin ich erleichtert, dass ich ihn gleich am Apparat habe. Ich schildere ihm die Situation. „Unternehmen Sie um Himmels willen nichts selbst. Wir sind in zwanzig Minuten vor Ort.“
Ich knie mich neben die beiden angeschlagenen Jugendlichen. Die haben sich mittlerweile ein wenig beruhigt. „Was war los?“
Ich erkenne jetzt Michael Meyer hinter seinem Gesichtsverband. Auch ein ehemaliger Konfirmand. Mit seinem Großvater Frieder Meyer hatte ich in meinen Angangsjahren hier im Ort heftige Auseinandersetzungen. Mit der nächsten Generation bin ich gut ausgekommen. Michael war in der Konfirmandenzeit ein schüchternes Kerlchen. Das ist jetzt wie weggeblasen. Jetzt macht er auf harter Hund.
Gegenwärtig aber einigermaßen geknickt. „Ach, es war nichts, Herr Pastor. Nicht wirklich.“
Er sieht sich hilfesuchend um. Von seinen Kameraden kann er aktuell keine Unterstützung erwarten. Die sind zu sehr geschockt von den letzten Ereignissen.
„Und was genau?“
„Ach, nix. Wir waren im Bodrum, in dieser Eventbar. Lars’ Geburtstag feiern. Da waren diese Mädels. Wir haben nix gemacht, nur ein bisschen geflirtet. Und getanzt. Sie waren süß, sprachen nur wenig Deutsch. Plötzlich taucht dieser Gorilla auf und hat uns zusammengeschlagen. Schneller, als wir ‚Papp‘ sagen konnten. Wir sind in die Klinik gefahren und haben uns wieder zusammennähen lassen.“
„Und was soll das hier? Heute morgen?“
„Wir waren stinkesauer. Das können Sie sich doch denken. Wir sind mit unseren Mofas von Tankstelle zu Tankstelle geheizt, haben die Leute da befragt. Wenn überhaupt, dann wissen die Bescheid. Ein Typ am Esso-Nachtschalter an der Frankfurter Straße hat uns den Tipp gegeben, dass er eine Szene miterlebt hat, in der ein ukrainischer Mann drei junge Frauen zusammengeschrien hat. Eine hat wohl ein wenig Deutsch verstanden und dem Tankstellenmitarbeiter erzählt, dass das ihr älterer Bruder ist, der auf sie aufpasst. Und der jedes Mal ausraustet, wenn sie zu deutschen Jungs Kontakt aufnehmen.“
„Dieser Tankstellenmitarbeiter hat euch hierhergeschickt?“
„Er hat uns den Tipp gegeben. Aber wir haben vorher noch ein paar von unseren Bekannten aus der Berufsschule Fredenberg befragt. Da gibt es eine ganze Reihe Schüler aus der Ukraine. Wir haben Kontakte zu deutschen Schülern da, die haben die Angaben aus der Tankstelle bestätigt. Sie haben von einem Maxim erzählt, der in Groß Samtleben wohnt und ein schlimmer Finger ist, dass über ihn erzählt wird, dass er seine Schwestern terrorisiert.“
„Und dann?“
„Wir sind hierher und haben zuerst gefordert, dass der Typ rauskommt. Die junge Frau, die eben angeschossen wurde, war auch da. Sie ist aus dem Nachbarhaus rausgekommen und hat uns gewarnt. ‚Maxim ist gefährlich.‘ Das ist der mit der Flinte.
Er kommt raus und will schon wieder auf uns einschlagen. Da haben wir ihm ein paar Steine in die Fenster geworfen. Er ist zurück ins Haus und kommt mit diesem Gewehr wieder raus. Den Rest haben Sie miterlebt.“
Ringsherum plötzlich Aufruhr. Zwei Streifenwagen und ein Mannschaftswagen. Eine Gruppe schwerbewaffneter Polizisten in Kampfmontur springt raus und stürmt ins Haus. Ein Schuss fällt. Ein Schrei. Aber eher ärgerlich als in Todesangst. Der als Maxim bezeichnete Mann wird herausgeführt. Links und rechts haben ihm Polizisten den Arm umgedreht. Einer drückt ihm den Kopf runter, als er in einen der Streifenwagen geschoben wird. Der fährt sofort mit quietschenden Reifen los.
Kommissar Hering hat sich mit zwei weiblichen Polizisten zu den Jugendlichen gesellt und befragt die Gruppe.
Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich winke Lars Viersen zu und mache mich auf den Weg zur nächsten Station dieses für meinen Geschmack reichlich reizüberfluteten Arbeitstages.
3
Geburtstagsbesuch. Achtzigster Geburtstag. Elvira Zahn, genannt Mary. Warum auch immer. Groß Samtlebener Urgestein.
Eine völlig andere Situation als bei den meisten dörflichen Geburtstagsbesuchen. Kein Männergesangverein. Der ist ohnehin mangels Mitgliedern seit einiger Zeit nicht mehr auftrittsfähig und trifft sich nur noch zum Bier.
Außer mir keine Dorfhonoratioren. Zumindest bis jetzt nicht.
Im Hintergrund läuft Jimi Hendrix auf Dauerschleife. „And the wind cries Mary.”
Die versammelten Herrschaften und Damen haben sich feingemacht. Alle ungefähr im Alter von Frau Zahn. Chic. Aber kein dörflicher Sonntagsstaat. Eher das, was man in der 68er-Generation cool fand.
Ich kenne Frau Zahn schon lange. Sie ist in Groß Samtleben geboren. Aber hier nicht geblieben. Sie hat in den Jahren der 68er-Studentenrevolte in Göttingen studiert. Forstwirtschaft. Soweit ich weiß, war sie politisch nicht besonders engagiert. Aber sie hat viel von dem Lebensgefühl dieser Jahre aufgesogen. Und in unser Dorf mitgebracht, als sie die Revierförsterei in Groß Samtleben übernommen hat. Niedersächsische Landesforsten.
Frau Zahn ist im Dorf sehr beliebt. Immer noch im hohen Alter und all die Jahre, in denen ich sie miterlebt habe.
Sie war in der Kirchengemeinde nicht engagiert. In der Regel kam sie zu den großen Festtagsgottesdiensten. Wenn sie nichts Besseres vorhatte.
Ich habe immer gern mit ihr geklönt, wenn wir uns auf der Straße getroffen haben. Oder nach einem der Gottesdienste, die sie mit ihrer Anwesenheit beehrt hat. Eine kluge und lebenslustige Frau.
Sie hat ein gutes Standing im Ort. Auch und gerade bei den Alteingesessenen. Mittlerweile weiß ich, dass das Gerücht Unfug ist, dass das Dorf nur einen angepasst konservativen Lebensstil akzeptiert. Wenn die Leute wertschätzend behandelt werden, können sie fast alles mitmachen.
„Guten Morgen, Herr Pastor!“ Elsbeth Zahn, die Tochter, organisiert die Feier. Sie begrüßt mich mit Handschlag. „Wir wissen schon, dass Sie keinen Schnaps wollen ...“
„Doch, heute morgen schon. Es war einiges los diese Nacht ...“
„Wir haben gerade drüber geredet.“ Sie drückt mir einen Nordhäuser Doppelkorn in die Hand. „Eine aufregende Geschichte.“ Sofort bricht das Gespräch wieder los. Ich sehe mich um. Es sind doch einige Leute aus der Dorfehrbarkeit zugegen. Ich habe sie bloß nicht gleich erkannt. Sie haben sich alle im Chic der 68er-Generation verkleidet. „Das habe ich mir gewünscht.“ Elvira Zahn lächelt verschmitzt.
Ich erkenne nach und nach:
Horst Kleinhans, Sohn des langjährigen Ortsbürgermeisters und Vorsitzenden der Lustigen Karnevalsjecken Groß Samtleben.
Eine übrigens reichlich riskante Fusion mangels Mitgliedern aus den beiden generationenlang verfeindeten Karnevalsvereinen im Ort, Lustige Jecken Groß Samtleben und Karnevalsverein Groß Samtleben. Die Gerüchteküche im Dorf brodelt von Nachrichten. Jetzt meistens über Facebook oder Instagram. Die Feindschaft soll weiterhin ungebremst lebendig sein. Sie zündelt jetzt mitten durch den neuen Fusionsverein hindurch an den alten Vereinsgrenzen entlang.
Horst Kleinhans hat beide Funktionen übernommen, die des Ortsbürgermeisters und des Leiters des Fusionsungetüms. Außerdem ist er wie sein Vater Feuerwehrhauptmann. Ämterhäufung, Machtzusammenballung und Selbstüberforderung liegen im Familienblut.
Dann Meike Hermannssohn, Leiterin des Gospelchors. Der ist entstanden, nachdem der Kirchenchor wegen Mitgliederschwunds dahingeschieden ist. Die junge Frau ist ein Segen für die Kirchengemeinde und für das Dorf. Sie arbeitet als Lehrerin an der Grundschule, lebt selbst im Dorf, ist frisch, attraktiv und animiert junge Leute zwischen zwanzig und vierzig zu Singen und Geselligkeit. Viele sind heute morgen bei der Geburtstagsfeier mit dabei.
Und Margot Windkamp. Verwitwete Richtergattin und Schlossherrin im Barockschloss Groß Samtleben – allerdings nur zur Miete. Frau Windkamp ist treibende Kraft und bleibende Seele des Tante-Emma-Ladens „Wir bleiben hier“.
Das Gespräch hat sich von der Gewalteskalation der letzten Nacht zur Frage hinbewegt, wie mit den ukrainischen Familien im Ort umgegangen werden kann.
„Die Familien sind einfach zu laut.“ Das kommt aus der Ecke der Feuerwehrleute.
„Die Erwachsenen wollen kein Deutsch lernen, weil sie ja wieder zurückwollen, wenn der Krieg vorbei ist.“
„Das kann doch nicht angehen, dass der Landrat und die Großgemeinde Salzgitter so tun, als müssten Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, nicht wie andere Geflüchtete behandelt werden.“ Das Geburtstagskind schaltet sich engagiert ins Gespräch ein.
„Genau. Die Geflüchteten aus Syrien oder Afghanistan oder den afrikanischen Kriegsgebieten sind doch genauso Menschen. Sie mussten genauso ihre Heimat verlassen. Sind genauso traumatisiert.“
Die Stimmen werden erregter. „Und dann bekommen die Ukrainer sofort Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, werden finanziert, ihnen werden in unserem Dorf sogar kostenlos ganze Häuser zur Verfügung gestellt!“
„Die Ampel in Berlin redet ständig von dreihunderttausend Geflüchteten. Die kommen aus Afghanistan oder Syrien. Oder aus afrikanischen Kriegsgebieten. Sie werden schlecht behandelt. Dabei sind mehr als eine Million ukrainische Geflüchtete im Land. Weit mehr. Wenn man sich endlich mal ehrlich machen würde und nicht so tun würde aus lauter moralischem Übereifer, als seien die Ukrainer kein Problem für die Kommunen. Oder gar nicht da.“
„Aber ihr wollt die doch wohl nicht alle ausweisen?“ Elvira Zahn hat sich im Rollstuhl aufgerichtet und guckt böse in die Runde.
„Nein, na klar. Wollen wir alle nicht. Wir wollen mehr Gleichheit. Und mehr Ehrlichkeit.“
Das sind keine AfD-Leute oder Rechtsextremisten, die sich hier ereifern. So reden und denken viele, bis in die Leitung der Kommunen hinein. Ich kann das verstehen.
Nicht verstehen kann ich die Nazis im Dorf. Das ist heute ein anderes Kaliber als die alte Nazigeneration der Wendezeit. Das sind junge Leute. Gut ausgebildet. Finanziell gut abgesichert. Sie sind „völkisch“ orientiert und wollen, dass alle Geflüchteten aus Deutschland „remigriert“, also vertrieben werden.
Das verfängt bei vielen. Gerade bei jungen Leuten.
Das ist unerträglich.
Ich mache mir eine Notiz im Kopf, dass ich mit dem Landesbischof darüber sprechen muss. Und beim nächsten Fürbittengebet darauf eingehen will.
In Groß Samtleben und Klein Samtleben haben „völkische“ Familien vier leerstehende Bauernhöfe gekauft. Sie mussten nicht mal viel investieren. Diese Familien haben viele Kinder. Und sie zeugen viele Kinder, schon aus ideologischen Gründen. Sie sitzen in den Elternbeiräten des Kindergartens und der Schule. Sie drängen in den Kirchengemeinderat. In einem Vierteljahr wird gewählt, und es gibt drei „völkische“ Kandidaten.
Ich bin in Sorge, dass ich die Faschos im eigenen Hause haben werde. Wenn kein Wunder geschieht.
Es klingelt. Auftritt Knut Scheinhaus. Mit einem großen Blumenstrauß und einer Flasche Crémant unterm Arm. Er drängt sich an Elsbeth Zahn vorbei und baut sich in der Mitte des Raumes auf. „Verehrtes Geburtstagskind ...“, tönt er.
Das war laut. Aber das war’s dann auch schon.
Immer derselbe blöde Fehler. Scheint der Großgrundbesitzerfamilie im Blut zu liegen.
Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben.
Jetzt baut sich nämlich gerade der Gospelchor auf. Mit lautem Remmidemmi.
Bei Licht besehen sind das bestimmt zwei Drittel der Anwesenden.
Oh happy Day von den Edwin Hawkins Singers. Richtig zum Hit geworden durch die Coverversion von Lauryn Hill im Blockbuster Sister Act 2.
Tosender Beifall. Der Chor klatscht mit.
Dann: Happy Birthday von Stevie Wonder, hier eine Gospelfassung.
Und schließlich: „Wie schön, dass du geboren bist.“
Jetzt hat die Jubilarin Tränen in den Augen.
Knut Scheinhaus sieht seine Chance. Er bekommt sie. „Liebe Elvira Zahn, jetzt bist du die drittälteste Jubilarin in unserer Gemeinde. Und zu jedem Weihnachtsfest ein Grund, sich doppelt zu freuen ...“
„Gebt Knut mal einen Schnaps.“ Elvira Zahn schaltet sich lautstark ein. „Danke, Knut, dass du gekommen bist. Aber ich kenne dich von Kindesbeinen an. Warum so offiziell? Du weißt doch, dass ich meinen Nachnamen kenne.“
Allgemeines Gelächter.
„Und Heiligabend ist erst in zehn Tagen. Du hast also die Chance, dich bald schon wieder zu freuen – und dann aus eigenständigem Anlass.“
Knut Scheinhaus will schmollen, bekommt dann aber einen Doppelkorn und stimmt ins allgemeine Gelächter ein. Ich proste ihm freundlich zu. Er ist hart im Nehmen. Das gefällt mir. Immerhin.
Mein Handy klingelt. Ich gucke das Geburtstagskind entschuldigend an. „Nun machen Sie schon, Herr Pastor.“ Ich gehe auf den Flur.
„Kai hier.“
Die Stimme ist panisch. So kenne ich ihn gar nicht. „Kannst du mich abholen?“
„Was ist los?“
„Es ist nicht viel passiert.“ Schweigen.
„Wo bist du?“
„Am Ortseingang von Lebenstedt. Es ist nur eine Platzwunde. An der Augenbraue.“
Wieder Schweigen.
„Ich blute bloß wie verrückt. Bringst du mich in die Notaufnahme?“
„Willst du nicht lieber einen Notarzt? Was ist überhaupt passiert?“
Er schweigt schon wieder. Muss sich anscheinend sortieren.
„Bitte mach schnell. Die Kattowitzer Straße ist nicht weit weg. Notaufnahme im Helios.“
Es hat keinen Zweck, weiter nachzufragen. Ich winke der Geburtstagsgesellschaft zum Abschied zu. „Ein Notfall. Muss leider sofort los.“
Allgemeines Bedauern. Das geht nicht tief. Die Gespräche gehen sofort weiter.
Ich renne im Dauerlauf zum Pfarrhaus.
Da steht er. In der Garage.
Ich habe eine teure Meise.
Alte Autos.
Das fing mit einer Ente an, 2CV. Und dann einem Mercedes 180, Baujahr Fünfziger-jahre. Beide geschenkt.
Seit ich eine Schrauberwerkstatt gefunden hatte, gab es kein Halten mehr.
Borgward P 100. Der größte, schnellste und schönste Borgward. Kurz bevor diese wunderbare Bremer Autofirma 1961 schlagartig in Konkurs ging. Was für ein Jammer.
Ich habe einen ergattert. Hat mich mitsamt Rekonstruktion und jahrelangem Warten viele Monatsgehälter gekostet. Und unendlich viele Nerven.
Es gibt in Deutschland nur noch fünfzig fahrbereite Exemplare.
Ich habe einen P 100. Ich liebe ihn. Ich starte ihn. Genieße den satten Sound der sechs Zylinder. Fahre so schnell wie möglich zu der von Kai bezeichneten Stelle.
Kai steht mit blutüberströmtem Gesicht am Straßenrand. Hinter ihm im Graben ein zerbeulter Smart.
Ich werde nachher bei Brandhorst anrufen. Autowerkstatt in der Schlossstraße. Die sollen den Smart abschleppen und durchchecken.
Wenn Kai versorgt ist.
Ich halte direkt neben Kai, stoße die Tür auf. Er kippt in den Wagen. Er wird mir das Polster vollbluten. Ich werfe ihm ein Handtuch rüber, das auch schon Motoröl gesehen hat. Er ist so clever und hält es nicht auf, sondern unter die blutende Wunde.
„Los, erzähl!“
„Dieser Wagen war plötzlich da. Wie aus dem Nichts. Er hat mich überholt. Dann abgedrängt. Ich bin in den Graben geschossen. Zum Glück zwischen den Bäumen durch und nicht gegen einen ...“
„Du meinst, das war gewollt? Der wollte dich in den Graben schubsen?“
Kais Schultern zucken. Er ist komplett aufgelöst. „Ja, das glaube ich.“
Details
- Seiten
- 180
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (Buch)
- 9783958942950
- ISBN (eBook)
- 9783958942967
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (April)
- Schlagworte
- Krimi Gemeinde Pfarrer Bischof Verbrechen